„Anfang 20, Masterabschluss und 15 Jahre Arbeitserfahrung“: wir haben die Person getroffen, nach der in unrealistischen Stellenanzeigen gesucht wird. Rob Stamm. Warum er keine Angst vor der Zukunft hat und glaubt, dass Länder wie die USA von Entwicklungsländern abgehängt werden.
Rob Stamm, 23, kommt in den Raum und stellt seinen schwarzen Rucksack neben dem hohen Bartisch mit Marmorplatte ab, an dem wir sitzen. Er schenkt uns ein schiefes Lächeln und eine so herzliche Umarmung, als wären wir schon ewig befreundet. Dabei haben wir uns eigentlich erst ein paar Tage vorher auf einer Party kennengelernt.
Unterwegs ist er normalerweise mit dem Longboard, die New Yorker Subway ist ihm einfach zu unzuverlässig, heute hat er es ausnahmsweise nicht dabei. Seine Smartwatch leuchtet auf, wenn eine neue Nachricht aufploppt. Das lenkt ihn aber nicht von unserem Gespräch ab. Die weißen Kopfhörer sind kabellos. Also die Version, bei der sich unsere Eltern fragen, ob die nicht eigentlich kaputt sind. Er freut sich auf Kontaktlinsen, die mit Messaging-Apps wie Slack gekoppelt sind und auf eine Kooperation von Ray Ban und Google Glasses. Dann können Augmented- und Virtual Reality auch endlich Mainstream werden. Er kommt richtig ins Schwärmen, wenn er so über die Zukunft spricht. An Geschäftsideen scheint es ihm jedenfalls nicht zu mangeln – auch ohne Kaffee, den trinkt er nämlich nicht.
Wenn du damit wirbst, alles zu können, werden Leute skeptisch.
Eine ganz gute Geschäftsidee hatte er auch schon. Um genau zu sein vor eineinhalb Jahren, als er seine eigene Digitalagentur gründete, die an der „front line“ von all diesen Entwicklungen steht. Rob’s Agentur heißt Wedia, die Abkürzung für „we do it all“ (zu deutsch: wir machen alles). Hauptsache es ist digital. Eigentlich fast ein Widerspruch, wie Rob selbst sagt: „Wenn du damit wirbst, alles zu können, werden Leute skeptisch. Das bedeutet nämlich, dass du in Wahrheit gar nichts kannst“, sagt er und lacht. In seinem Fall ist damit aber gemeint, dass in der Agentur alles intern geregelt wird.
Wenn ein Kunde, in den meisten Fällen Tech-Start-Ups, einen neuen Webauftritt in Auftrag gibt, denkt Rob direkt weiter: Die meisten brauchen neben einer Website auch ein Logo, professionelle Fotos von den MitarbeiterInnen und eine Strategie für Social Media. Das alles kann umgesetzt werden, ohne, dass sich der Webentwickler, die Grafikdesignerin und der Fotograf während des gesamten Prozesses in echt begegnen. „Remote Agency“ nennt sich sowas dann, wenn alle MitarbeiterInnen, die Rob übrigens lieber „Talente“ nennt, eigentlich nur eins brauchen, um arbeiten zu können: eine Internetverbindung. Was Rob daran schätzt, ist die Freiheit: „Du kannst auch von Hawaii aus arbeiten, solange du auf deine E-Mails antwortest.“
Kunden wollen lieber E-Mails bekommen, als eine Textnachricht
Auch wenn er selbst von dem Konzept überzeugt ist, raushängen lässt er es vor Kunden nicht direkt. „Viele werden skeptisch, wenn ich sage, dass wir von zuhause aus arbeiten und fragen sich, ob wir auch wirklich miteinander kommunizieren.“ Die Zusammenarbeit im Team funktioniert fast ausschließlich über digitale Kanäle: Jeden Montag und Freitag gibt es eine Telefonkonferenz, bei der sich alle auf den neuesten Stand bringen. Abseits davon wird über Slack, Skype und Google Drive kommuniziert. Allerdings nur intern, die Kunden bevorzugen Robs Aussagen nach immer noch die klassische E-Mail und sollen die internen Team-Dokumente auch gar nicht sehen. Seinem Team gegenüber ist Rob transparent, Dokumente wie Gehälter und Stundenlöhne, sind frei zugänglich: „Alle wissen genauso viel wie ich.“
Diese gegenseitige Vertrautheit ist ihm als Chef besonders wichtig. Auch wenn ihm die Bezeichnung „Chef“ überhaupt nicht gefällt. „Ich habe ja eigentlich keine Angestellten, für die ich ein Chef sein kann, weil alle Teammitglieder Freiberufler sind.“ Dass alle Verträge nur projektbasiert sind, ist nicht ganz uneigennützig, wie er uns selbst erzählt: „Ich muss für keine Krankenversicherungsbeiträge aufkommen und keine Miete für ein Büro bezahlen.“ Außerdem habe er so keinen Druck, dauerhaft 20 Leute mit Aufträgen zu versorgen. Ein weiterer Grund sei die besondere Arbeitsethik: „Bei jedem Projekt wird sich neu für die Zusammenarbeit entschieden. Sie arbeiten also weil sie wollen, nicht weil sie müssen.“
Jeder ist austauschbar, auch ich selbst.
Er ist stolz darauf, erfolgreich zu sein. Es ist das, wofür er morgens aufsteht. Aktuell arbeitet er fast nur mit Freunden zusammen, weshalb sich das Team für ihn wie eine Familie anfühlt. „Deine KollegInnen bezeichnest du als Familie?“, fragen wir verwundert. Anstatt zu antworten, stellt er uns eine Gegenfrage: „Wie viel Stunden pro Woche verbringt ihr aktuell mit eurer Familie?“ Keine. „Und wie viel Zeit verbringt ihr drei miteinander?“ 24/7. „Da habt ihr es.“
Rob macht sich aber keine Illusionen. „Ich weiß, dass jeder austauschbar ist. Auch ich selbst“, sagt er lächelnd und hinterlässt keinen Zweifel, dass er das auch wirklich so meint. Deshalb kümmert er sich um seine Teammitglieder und fragt auch mal nach, wie das Date gelaufen ist. Umso schwieriger ist es, von Freunden zu verlangen, das eigene Privatleben in den Hintergrund zu stellen. Vor allem, wenn es um kurzfristige Projekte geht und Kunden von einem größeren Team ausgehen, als es eigentlich ist. „Da frage ich schon mal nach, ob das Date mit der Freundin verschoben werden kann.“ Wenn man sich so nah ist wie in einer Familie, kann man auch schneller verletzt werden: „Natürlich fällt es mir schwer, einem Freund zu sagen, dass er nicht ins Team passt.“ Trotzdem würde er lieber auf einen Freund verzichten, als das komplette Team „zu schwächen“. Zum Glück ist es dazu noch nicht gekommen.
Wer Angst vor der Zukunft hat, kann nicht gewinnen

Wer Rob allein von seinem Aussehen her bewerten müsste, würde ihn wahrscheinlich ziemlich unterschätzen. Kurze Haare, schlaksiger Körper, einfaches T-Shirt und Jeans. Irgendwie unscheinbar, irgendwie ein bisschen wie Mark Zuckerberg, nur jünger. Hört man Rob jedoch reden, versteht man, wieso er es schon so weit gebracht hat. Seine Mimik und Gestik unterstreichen seine Worte beinahe perfekt. Es überrascht nicht, dass er Leute von sich überzeugen kann. Und er ist extrem optimistisch, egal um welches Thema es geht: „Es ist schade, wie negativ viele über die Zukunft sprechen“, sagt er. Seiner Meinung nach ist es die fehlende Anpassungsfähigkeit, die vielen die Sicht auf die Vorzüge versperrt.
„Wenn du Webentwickler bist und plötzlich wird deine Codiersprache nicht mehr verwendet, bist du nutzlos.“ Natürlich sei das hart, aber auch hier sieht er wieder die positiven Seiten. Denn heutzutage sei für jeden alles möglich. Ist das wirklich so? Die eigentliche Schwierigkeit liegt für ihn eher darin, den Beruf zu finden, der am besten zur eigenen Persönlichkeit passt. „Du kannst nur dann richtig gut in etwas sein, wenn die Motivation intrinsisch ist.“
Auch der stetige Wandel ist für ihn eher Vor- als Nachteil: „Unsere Generation kennt es doch gar nicht anders. Wir wissen, dass man sich immer wieder neu ausrichten muss.“ Trotzdem glaubt er, dass Leute auf der Strecke bleiben werden. Vor allem Ältere, für die alles neu ist. Aber auch dafür fällt ihm direkt eine Lösung ein: „Ich könnte mir vorstellen, dass Unternehmen entstehen, die ältere Menschen schulen und erklären, warum es wertvoll ist, Dinge anders zu machen.“ So schnell wird es aus seiner Sicht dann doch nicht gehen, bis uns Roboter von unseren Arbeitsplätzen verdrängen. Dafür würden veraltete Infrastrukturen schon sorgen.
Veraltete Infrastruktur wird viele Jobs “retten”
Was Rob damit meint? „Wir können Menschen zum Mond schicken, aber ich kann nicht mit der U-Bahn nach Midtown fahren, ohne dass die Bahn mindestens einmal stehen bleibt. Das darf nicht sein.“ Das U-Bahnsystem in New York City ist veraltet, das haben auch wir schon mehrfach erlebt. Auch Strom- und Abwasserleitungen sind längst überholt. Auf Toiletten umzusteigen, die unsere Ausscheidungen erst in Wasser und dann in Strom umwandeln sieht er in den USA erstmal nicht. In Ghana hingegen wurde das schon getestet. „Die Länder, auf die wir gerade noch herabschauen, werden uns mit einzigartigen Technologien überholen, weil sie nicht damit beschäftigt sind, veraltete Systeme auszubessern.“
Apropos veraltetes System. Auch das amerikanische Bildungssystem hält er für überholt: „Es kann doch nicht sein, dass uns Professoren, die seit 30 Jahren an der Universität forschen, etwas über Entrepreneurship beibringen sollen“, sagt er lachend. Deshalb absolvierte er selbst sowohl seinen Bachelor- als auch Master Online und reiste nebenbei. Er ist sich aber bewusst, dass nicht alles online beigebracht werden kann: „Natürlich möchte ich nicht von einem Arzt am Herzen operiert werden, der seinen Abschluss online gemacht hat.“ Rob hält es für sinnvoller, wenn erfolgreiche Personen aus der Praxis, wie Elon Musk, Vorlesungen halten würden. Die wären auf dem neuesten Stand, könnten aufgezeichnet werden und so viel mehr Menschen erreichen.
Ich würde gerne in der Jury von Shark Tank sitzen
Schon nach fünf Minuten unseres Gesprächs ist klar: Rob will ganz groß rauskommen. Womit genau, ist ihm nicht wichtig. Aber er geht fest davon aus, dass er das auch schaffen wird: „Ich würde gerne in der Jury von Shark Tank (dem amerikanischen Pendant zur Höhle der Löwen) sitzen und kleinen Unternehmen dabei helfen, groß rauszukommen, um sie dann weiterzuverkaufen.“ So ähnlich stellt Rob sich auch die Zukunft seiner eigenen Agentur vor – zehn Prozent behalten und den Rest gewinnbringend verkaufen. „Klar ist die Agentur mein Baby. Aber ich bin Unternehmer, ich möchte mich auch noch in fünf andere Dinge stürzen.“ Trotz dieser Pläne hat er sich zwei Stunden für uns Zeit genommen.
Leidenschaft, harte Arbeit und Proaktivität. Das braucht es aus Robs Sicht, um zukünftig erfolgreich zu sein und sich Veränderungen anpassen zu können. „Wenn du Webentwickler bist und schon weißt, welches Feature in einem halben Jahr interessant sein könnte, erwarte ich, dass du proaktiv bist und ich nicht warten muss, bis der Kunde selbst danach fragt.“
Diese Einstellung scheint sich für ihn auszuzahlen: „Ich bin 23, sehe aus wie 17 und habe schon Meetings mit 15 Leuten gehalten, bei denen ich für den Praktikanten gehalten wurde“, sagt er und lacht herzlich. Es macht ihm aber nichts aus, für so jung gehalten zu werden. Ganz im Gegenteil: Er nutzt den Vorteil unterschätzt zu werden und möchte am liebsten für immer so jung bleiben.“Ich glaube ich muss gleich mal bei Elon Musk anrufen und fragen, ob er schon an einer Pille dafür arbeitet.“
Titelbild: Johanna Felde
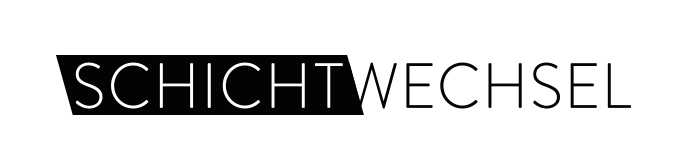
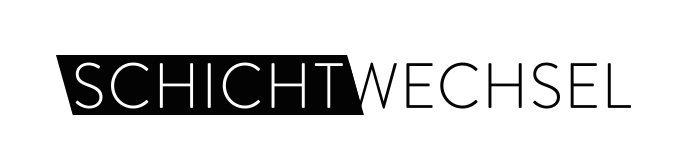

Comments are closed.