Marode Infrastruktur, überteuertes Gesundheitssystem, extreme soziale Ungerechtigkeit: Es gibt vieles, was man an den USA kritisieren kann. Dennoch sind Nikolina und Martin Klatt glücklich mit ihrer Entscheidung nach New York gezogen zu sein. Was Deutschland von den USA lernen kann, warum afroamerikanische Kinder auf Festnahmen vorbereitet werden und was sie sich für die Zukunft der Arbeit wünschen. Ein Interview.
Eigentlich soll man als JournalistIn objektiv sein und sich nicht auf eine Seite stellen. Das ist auch gut so! Aber weil wir ein Blog sind und kein Nachrichtenmedium, können wir es euch ja sagen: Nikolina und Martin Klatt gehören zu den inspirierendsten und offensten Menschen, die wir seit langer Zeit getroffen haben. Wir sind große Fans des deutschen Ehepaars, das seit über einem Jahr in New York lebt. Bei bestem Sommerwetter haben wir sie auf Roosevelt Island getroffen. Einer ruhigen Insel mitten im East River, von der man einen herrlichen Ausblick auf die Skyline von Manhattan hat (klarer Touri-Tipp).
In die USA sind die beiden für einen dreijährigen Forschungsaufenthalt von Martin gekommen, der hier als Krebsforscher arbeitet. Nikolina ist studierte Kunsthistorikerin, hat aufgrund der Visa-Bestimmungen aber erstmal keine Arbeitsgenehmigung bekommen. Davon hat sie sich aber nicht unterkriegen lassen, sondern die Zwangspause genutzt, um sich ehrenamtlich bei der UN zu engagieren. Das hat sie wiederum so fasziniert, dass sie seit kurzem im Fernstudium Politikwissenschaft studiert. Das Fazit der beiden nach einem Jahr New York: Es war die beste Entscheidung, auch wenn sie einiges an den USA stört. Wir haben mit ihnen über Unterschiede zwischen Deutschland und den USA gesprochen, was sie an den USA am meisten schockiert und was sie sich für die Zukunft der Arbeit wünschen.
Ihr lebt seit einem Jahr in New York. Was sind für euch die großen Unterschiede zu Deutschland?
Martin: Wie viel Zeit habt ihr? (lacht) Nein, im Ernst, das Thema Nachhaltigkeit ist hier zum Beispiel sehr schwierig. Im Durchschnitt wird mehr Müll produziert und mehr Autogefahren als bei uns. Wenn ich mir dann gleichzeitig die Leute bei uns im Labor anschaue: Alles AkademikerInnen – und selbst die denken nicht über das Thema Nachhaltigkeit nach und sind nicht so reflektiert, wie man es erwarten würde.
Nikolina: Ich würde auch sagen, dass die Menschen hier in den USA nicht so kritisch sind. Über allem schwebt immer noch dieser „Weltmachtsgedanke“. Wenn man sich dann die Infrastruktur hier anschaut, kann man eigentlich nur lachen.
Wieso lachen?
Martin: Wir haben vorher eine Pazifikreise gemacht und waren auch in Vietnam. Als wir dann hier in New York angekommen sind, haben wir erstaunlich viele Parallelen festgestellt. Vor allem, was die Straßenqualität, Überfülltheit und Dreckigkeit angeht.
Nikolina: Man muss dazu sagen, dass wir auch in Tokio und Melbourne waren. Unsere Assoziationen in New York gingen aber nur in Richtung Vietnam.
Martin: Meine Theorie zu dem „Weltmachtsgedanken“ ist ja diese: Der Gedanke wurde in den 70er und 80er Jahren zementiert. Danach hat man in den USA einfach nicht mehr viel daran gearbeitet, dass es auch weiterhin so bleibt.
Ein großes Thema ist ja auch das Gesundheitssystem. Wie siehst du das als Mediziner, Martin?
Martin: Ja, hier gibt es definitiv einen großen Unterschied zu Deutschland. Man wird hier in den USA viel mehr allein gelassen. Ärzte erklären weniger und setzen eine hohe Eigenverantwortung voraus. Außerdem erwarten sie, dass man ihren Anweisungen folgt. Deswegen ist der Patient in den USA deutlich unmündiger als in Europa oder speziell in Deutschland. Sie bevormunden einen aber insgesamt in den USA sehr gerne – damit man nicht in verklagungswürdige Situationen kommt. Daraus resultiert dann auch eine Übervorsichtigkeit.
„Kinder afroamerikanischer Herkunft lernen hier schon in der Grundschule, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie von der Polizei angehalten werden.“
Welche Unterschiede nehmt ihr ansonsten noch wahr?
Martin: Der Punkt, der mich am meisten bewegt: Auch wenn wir in Deutschland schon eine recht breite soziale Schere haben, die Schere hier in den USA ist nochmal extremer. Am Ende ist es auch das, was das Land vor die größten Probleme stellt.
Wie bemerkt man diese Schere?
Martin: Menschen mit afroamerikanischen Wurzeln wird der soziale Aufstieg unglaublich schwer gemacht. Ich sehe das auch bei uns im Labor. In unserem kompletten Gebäude arbeiten 1000 Leute – davon sind drei Afroamerikaner. Der Grund ist, dass diese Leute nicht auf den „richtigen“ Universitäten waren, weil sie sich die wiederum nicht leisten können. Hier zählt vor allem der Name der Universität. Da entsteht dann dieser Cut und über den kommst du nicht drüber.
Nikolina: Wenn man sich dann aber anschaut, wer den Bus fährt, wer im Hauseingang als Doorman sitzt, wer die Flure putzt: AfroamerikanerInnen oder MexikanerInnen.
Martin: Und genau das geht einfach nicht! Ihr müsst euch das mal vorstellen: Kinder afroamerikanischer Herkunft lernen hier schon in der Grundschule, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Einfach nur, damit nichts passiert.
Nikolina: Auch die Müttersterblichkeit ist bei afroamerikanischen Frauen absurd hoch. In Studien wurde dann auch untersucht, ob es in den Fällen einen Zusammenhang mit dem Bildungsgrad gibt. Gab es nicht.
Es ist erschreckend, wie wenig man in unserem Umfeld davon mitbekommt und wie schnell man das alles wieder vergisst.
Martin: Ja, das schockiert mich auch total. Hier verdient man zum Beispiel als MedizinerIn dreimal so viel wie in Deutschland. Die Argumentation ist folgende: Das Studium ist so teuer, deswegen kann man ruhig sein ganzes Leben so viel mehr verdienen. Ich habe daraufhin in meinem Labor mal rumgefragt, wie die Leute das eigentlich so finden. Die finden das alle in Ordnung, die Ungerechtigkeit sehen sie nicht…
Nikolina: …deswegen ist ja auch das ganze Gesundheitssystem so unglaublich teuer.
Martin: Das war eben auch mein Argument. Studien zeigen: Ein Grund, warum das Gesundheitssystem so teuer ist, sind die hohen Ärztegehälter. Wenn man daran schrauben würde, könnte die Versicherung auch wieder etwas bezahlbarer werden.

„Wenn es in Deutschland wirklich ums Eingemachte geht, wird gemauert.“
Martin, wie sieht es bei dir im Labor eigentlich mit der Frauenverteilung aus?
Martin: In der Forschung ist es insgesamt deutlich besser geworden. Bei uns im Labor ist es sogar 50:50. Man muss aber dazusagen: Es gibt deutlich mehr Medizinstudentinnen als Medizinstudenten. Wenn man sich dann anschaut, wie die Verteilung bei Oberarzt- oder Chefarztstellen ist, muss man leider sagen, dass da wieder hauptsächlich Männer sitzen. In der Forschung ist es sogar nochmal krasser. Laborleiterinnen gibt es bei uns auch nicht besonders viele: Von insgesamt 100 Laborleitern fällt mir gerade mal eine Frau ein.
Wir haben uns im WeLive mit einem Inder unterhalten, der uns von einem irritierenden Vorfall erzählt hat: Eine Inderin aus seinem Unternehmen sollte ein Meeting in München halten. Eine top ausgebildete Frau in einer Führungsposition. Die deutschen Männer in dem Meeting haben sie während ihres Vortrags quasi keines Blickes gewürdigt. Sobald drei Männer aus Pakistan, die nicht mal zu dem Unternehmen gehörten, ihren Part im Meeting abhielten, hörten die gleichen Männer gebannt zu. Außerdem hat ihn schockiert, dass es in Deutschland so wenige Frauen in Führungspositionen gibt und meinte im O-Ton: „Indien ist in diesem Punkt definitiv weiter als Deutschland”. Das hat uns schon ein bisschen schockiert.
Nikolina: Das ist wirklich schockierend. In den USA ist das auch etwas anders. Der Grund ist aber nicht schön: Die Arbeitsbedingungen sind hier zum Teil sehr schlecht. Man kann jederzeit angeheuert aber auch jederzeit gekündigt werden. Die normale Kündigungsfrist liegt nämlich bei zwei Wochen. Auch in führenden Positionen und egal, wie lange du in dem Unternehmen gearbeitet hast. Ich denke, dieser Umstand macht es Frauen manchmal leichter, wieder reinzukommen und so auch höhere Positionen zu haben. Gut ist das natürlich nicht. Normalerweise steigt man in den USA außerdem schon zwei Wochen nach der Geburt wieder voll ein.
Martin: Ich habe auch das Gefühl, dass Deutschland häufig nur sehr oberflächlich irgendetwas macht. Wenn es aber dann ums Eingemachte geht, wird umso mehr gemauert.
Was könnte sich Deutschland denn von den USA abgucken?
Nikolina: Ich habe hier in New York die Erfahrung gemacht, weniger gefragt zu werden, was ich beruflich mache. Das finde ich sehr angenehm. Es muss nicht immer um die Arbeit gehen. Wenn man dann doch mal darüber spricht, wird oft nur auf die Position, nicht auf das Unternehmen eingegangen.
Martin: Was die Amerikaner auch viel besser können als wir Deutschen: Alles über den Haufen werfen und einfach nochmal neu anfangen! QuereinsteigerInnen haben es hier viel leichter. In Deutschland hat man etwas studiert und das soll man sein ganzes Leben lang machen. “Wenn man etwas nicht von Anfang an gelernt bzw. studiert hat, kann man darin auch nicht gut sein”, so wird in Deutschland leider vielerorts gedacht. Deswegen wird man auch so schwer in andere Bereiche reingelassen.
In Deutschland wird gemotzt ohne Ende.
Nehmt ihr denn auch Unterschiede in der Arbeitsweise wahr?
Martin: Der größte Unterschied ist definitiv die fehlende Direktheit. Das lähmt oft die Produktivität. Manchmal wäre es einfach besser, wenn man ganz klar sagen könnte: „Das ist nicht gut. Wir müssen das jetzt ganz anders machen.“ Das würde aber hier keiner so direkt sagen. Und wenn es doch mal jemand macht, wird es sofort von anderen relativiert.
Nikolina: Aus meiner Sicht sind New Yorker aber schon etwas direkter als der Rest der AmerikanerInnen. Ich finde das auf der anderen Seite auch gar nicht so schlecht. In Deutschland wird gemotzt ohne Ende. Das kann ich auch nicht mehr hören. Nachdem wir genau ein Jahr hier gelebt haben, sind wir für einen Besuch zurück nach Deutschland. Diese Erfahrung war schon extrem.
Inwiefern extrem?
Nika: Die meisten waren leider sehr unfreundlich. Ich habe mal gehört, dass die Deutschen oft sagen, die Amerikaner seien aufgesetzt freundlich. Dann sind die Deutschen aber aufgesetzt unfreundlich.
Martin: Als MedizinerIn muss man mal in den USA geforscht haben, wenn man in der Forschung Karriere machen will. Denn wenn es um Grundlagenforschung geht, sind die Mittel für Forschung in den USA um ein zigfaches höher als in Deutschland. Ein Teil davon ist staatlich gefördert, ein großer Teil kommt aber auch von Privatpersonen. Solche Mäzene, die in Kategorien von 100 oder sogar 200 Millionen Dollar spenden, sind hier keine Seltenheit.
Wie kommt das?
Martin: Spenden ist in den USA gesellschaftlich sehr wichtig. Ein Beispiel dafür sind Bill und Melinda Gates mit ihrer riesigen Foundation, die die größte Privat-Stiftung der Welt ist. Mark Zuckerberg muss da dann auch mitgehen. Oder der Nike Gründer, der in Portland zweimal 500 Millionen Dollar für ein neues Krebszentrum gespendet hat. Das ist hier relativ normal. Deswegen sind in den USA auch ganz andere Mittel für die Forschung da. Kein Vergleich zu Deutschland. Du kannst einfach mehr Ideen verwirklichen, lernen und mehr Publikationen herausgeben.
In der Medizin wird alles noch teuer, bis es nicht mehr für alle bezahlbar ist.
Martin, wie denkst du denn, wird sich dein Beruf in Zukunft verändern?
Martin: In der Medizin wird es in Zukunft leider noch etwas technisierter, denke ich. Leider, weil es vielleicht besser wäre, wenn wir Mediziner wieder mehr persönlichen Kontakt zu PatientInnen hätten. Das Arzt-PatientInnen-Verhältnis wird aus meiner Sicht immer schlechter. Ich glaube außerdem, dass in der Medizin alles noch teurer wird – bis es nicht mehr für alle bezahlbar ist.
Was kann man aus deiner Sicht dagegen tun?
Martin: Ich würde mir als MedizinerIn alle Behandlungen immer sehr kritisch anschauen und überlegen, ob es wirklich etwas bringt. Oder ob es eine nette Spielerei ist, die man nur in der 1. Welt-Medizin einsetzen kann und dadurch ein paar Prozent mehr überleben, die anderen aber noch weiter abgehängt werden.
Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
Martin: Aus meiner Erfahrungswelt mit KrebspatientInnen kann ich sagen, dass die ältere Generation an ÄrztInnen oft nicht sagen kann, wann Schluss ist. Die Jüngeren können das etwas besser. Wir ÄrztInnen müssen uns fragen: „Wann ergibt eine Therapie noch Sinn und wann ergibt sie keinen Sinn mehr?“ Es muss um den Menschen gehen und man sollte sich auch klarmachen, dass der Mensch in Frieden versterben darf. Genau hier sehe ich das Potential, dass es in beide Richtungen gehen kann. Entweder kommen Jüngere nach, die ein besseres Gefühl für diese Situationen haben. Oder Ärzte werden das Gefühl haben, dass sie die Möglichkeiten noch mehr ausreizen müssen.
Nikolina, was denkst du über die Zukunft der Arbeit?
Nikolina: Ich glaube, dass es in Zukunft immer weniger ganz gerade Lebensläufe geben wird. Außerdem wird die Arbeit noch freier und noch ortsunabhängiger. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das gut finde. Mein Wunsch wäre auf jeden Fall die Abschaffung der 40-Stunden-Woche. Ich persönlich bin einfach produktiver, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten muss. Wer hat sich die 40 Stunden überhaupt ausgedacht? (lacht)
Wenn du einen Wunsch für die Zukunft frei hättest, welcher wäre es?
Ich bin Fan des bedingungslosen Grundeinkommens. Die Angst, die viele haben, dass wir dadurch faul werden, sehe ich nicht: Die meisten Menschen werden die Struktur in ihrem Leben, die sie durch ihre Arbeit bekommen, nicht verlieren wollen. Wir würden uns allen so viel Gutes damit tun, das wäre mein Wunsch.
Titelbild: Johanna Röhr
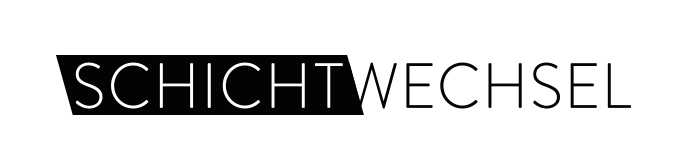
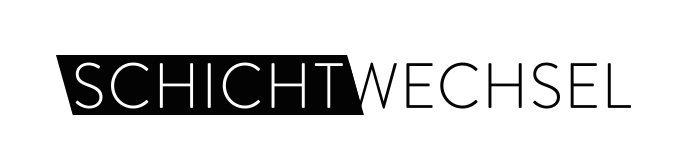

Comments are closed.